Wohnraum ist keine Ware – Vergesellschaftung jetzt umsetzen
Auf dem Börsenparkett kann man nicht wohnen. Und dennoch besitzen nicht Privathaushalte, Kleinvermieter*innen oder Kommunen, sondern Aktiengesellschaften die größten Wohnungsbestände unserer Republik. Viele dieser Wohnungen stammen aus öffentlichen Beständen, wurden mit Steuergeldern und Subventionen erbaut – und seit den 1990ern zu Spottpreisen privatisiert. Seit dem Ende der Wohnungsgemeinnützigkeit 1990 gaben Staat und Kommunen Wohnungspolitik in die Hände des Marktes.
Die Auswirkungen auf unsere Städte und ihr soziales Leben sind verheerend. Mietpreise steigen, das Angebot an leistbarem Wohnraum schrumpft weiterhin, Hunderttausende von Sozialwohnungen fallen aus der Bindung. Menschen rutschen in die Armut ab, oder werden aus ihrem sozialen Umfeld vertrieben
Doch eine Neuordnung des Wohnungsmarktes ist nicht in Sicht. Wo überhaupt eingegriffen wird, sind die Maßnahmen oberflächlich oder kosmetisch. Der „Milieuschutz“ ist seit der gerichtlichen Abschaffung des Vorkaufsrechtes völlig zahnlos, Ersatz ist nicht in Sicht. Ähnlich ging es auch der einzig mutigen Reform der letzten Jahre: dem Berliner Mietendeckel. Er weckte Hoffnungen auf eine Regulierung der Mietpreise, wie sie in der Gründerzeit der Republik selbstverständlich war. Doch ein in unseren Augen skandalöses Urteil des Bundesverfassungsgerichtes entzog den Ländern unter der Hand diese Kompetenz und brachte den Mietendeckel zu Fall.
Seitdem kommt aus der Politik gar nichts mehr, die Mieterinnen und Mieter werden alleine gelassen. Die einst im Mieterschutz federführende Berliner Landesregierung wirkt wie gelähmt, das im Wahlkampf 2021 gegebene Sozialdemokratische Versprechen eines „Mietenmoratorium“ ist längst gebrochen. Objektive Hindernisse für mutige Maßnahmen gibt es nicht: ein Bundesmietendeckel wäre morgen umsetzbar. Doch es fehlt der politische Wille.
Gegenimpulse kommen vor allem aus den sozialen Bewegungen unserer Städte, am deutlichsten jüngst aus Berlin: Eine Million Menschen forderten per Volksentscheid ein Gesetz zur Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne. Die hinhaltende Taktik des Berliner Senats gegenüber diesem Akt der Volkssouveränität ist ein Skandal, den wir verurteilen. 100 Tage Nichtstun bis überhaupt erst eine Kommission zusammentrat, deren Kompetenzen bis heute unklar sind – das ist das Gegenteil von dem versprochenen „Respekt“ für das Abstimmungsergebnis.
Das Fremdeln der Berliner Politik mit dem Volksentscheid zeigt, dass viele Entscheiderinnen und Entscheider noch nicht verstanden haben: Der Markt schafft keinen bezahlbaren Wohnraum.
Wir fordern daher die Abkehr von der Marktsteuerung im Wohnungswesen. Wohnungen sind keine Ware, sie gehören nicht an die Börse.
Bauen um jeden Preis ist auch in ökologischer Hinsicht für das Erreichen der Klimaziele keine Lösung. Der immense Ressourcen- und Flächenverbrauch im renditegetriebenen Bau- und Wohnungssektor macht auch in klimapolitischer Hinsicht ein Umsteuern hin zu demokratisch kontrolliertem und dem Gemeinwohl verpflichteten Wohnraum notwendig.
Erstes Ziel aller Wohnungspolitik müssen öffentliche und gemeinwirtschaftliche Eigentumsformen sein. Dieses Prinzip nennen wir „Vergesellschaftung“. Dazu gehört die Enteignung großer Wohnungskonzerne – aber auch politische Regulierungen, die Profite mit Wohnraum begrenzen, Mieterrechte stärken und die Bewirtschaftung von Wohnraum demokratischer Kontrolle unterstellen.
Folgende Schritte halten wir für notwendig:
– Partnerschaften, Runde Tische und ähnliche Abkommen mit Immobilienkonzernen waren bisher stets zum Schaden der Mieterinnen und Mieter. Sie sind sofort zu beenden, in Kommunen, Ländern und auf Bundesebene.
– Das von der Bevölkerung mehrheitlich gewollte Berliner Vergesellschaftungsgesetz muss ernsthaft angegangen werden. Die damit befasste Expert*innenkommission muss öffentlich tagen und konkrete Umsetzungswege aufzeigen.
– Bauen um jeden Preis ist keine Lösung. Wir brauchen keine Sozialwohnungen, die in wenigen Jahren wieder Spekulationsobjekt werden. Es muss daher in Bund, Ländern und Kommunen gelten: Öffentliche Gelder nur für Bauten in öffentlichem Eigentum oder in gemeinwirtschaftlicher Trägerschaft.
– Privatisierung von Wohnraum, aber auch Grund und Boden in öffentlichem und staatlichem Besitz muss gestoppt werden. Privatisierungsagenturen wie die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) aber auch die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) müssen radikal reformiert werden und zu Vergesellschaftungsagenturen werden, die öffentliches Eigentum gemeinnützig verwalten und vermehren.
– Die Bundesregierung muss den Mietendeckel freigeben. Wir brauchen eine sofortige Öffnungsklausel im Bundesrecht, die Länder und Kommunen erlaubt, Miethöhen wirksam zu regulieren.
– Das Vorkaufsrecht der Kommunen muss wiederhergestellt und gestärkt werden. Die Möglichkeit, einen Vorkauf per „Abwendungsvereinbarung“ zu stoppen, muss entfallen, Vorkäufe müssen deutlich unterhalb der gegenwärtig spekulativ überhöhten „Marktpreise“ möglich sein.
Mittelfristig müssen Maßnahmen wie Vorkaufsrecht und Mietendeckel und Zweckentfremdungsverordnungen zusammengeführt werden zu Wohnungswirtschaftsgesetzen auf Landesebene. Ihr Ziel muss sein, die Möglichkeit von Profiten mit der gegenwärtigen Wohnungsnot zu reduzieren und die Sozialpflichtigkeit des Eigentums wiederherzustellen. Auch hier muss der Bund Öffnungsklauseln erlassen, damit die Länder wirksame Regeln erlassen können.
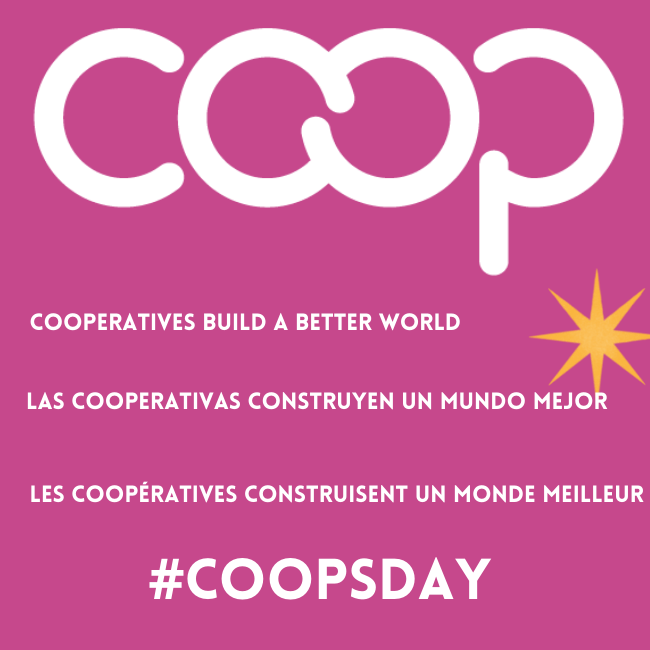 Erklärung der Genossenschafter*innen zum Internationalen Genossenschaftstag
Erklärung der Genossenschafter*innen zum Internationalen Genossenschaftstag
